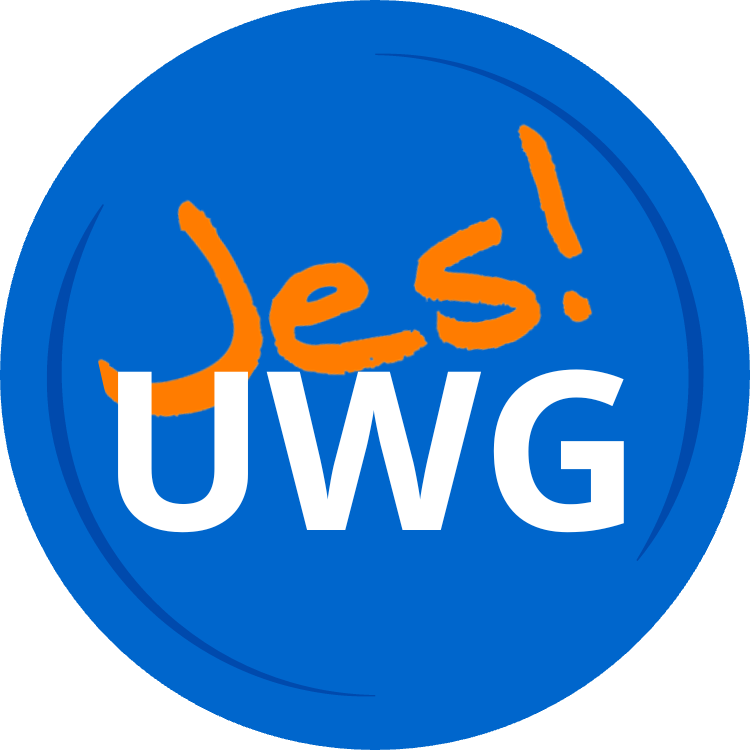Agri-PV in Thelstorf?
Energiewende ja – aber bitte mit klaren Spielregeln
Im Ortsteil Thelstorf soll eine bisher als PV-Freiflächenanlage geplante Fläche künftig als Agri-Photovoltaik-Anlage (Agri-PV) realisiert werden. Die Module sollen senkrecht („Solarzaun“) aufgestellt werden, die Fläche dazwischen soll – zumindest auf dem Papier – weiter landwirtschaftlich genutzt werden.
Im Fachausschuss „Bau und Planung“ haben sich alle Fraktionen dafür ausgesprochen, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan an die geänderte Projektkonzeption anzupassen. Auch die UWG hat dem zugestimmt – allerdings nur, um das Verfahren weiterzuführen. Eine inhaltliche Zustimmung zur konkreten Anlage ist damit ausdrücklich nicht verbunden.
Was Agri-PV rechtlich bedeutet – und was nicht
Mit dem Klimagesetz des Landes Niedersachsen und den dazugehörigen Regelungen wurde Agri-PV eine Sonderrolle zugewiesen:
- Agri-PV kombiniert auf derselben Fläche landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung mit der Stromerzeugung als Nebennutzung.
- Die Stromerzeugung darf nach Landesvorgaben maximal rund 15 % der landwirtschaftlichen Fläche beanspruchen, der weit überwiegende Teil muss weiter landwirtschaftlich nutzbar bleiben. Die Module sollen als senkrechte Reihen errichtet werden. Dazwischen sollen Traktoren und andere Geräte fahren.
- Agri-PV-Anlagen sollen die Ausnahme bleiben. Für sie gilt die gesetzliche Akzeptanzabgabe von 0,2 ct/kWh nicht.
Landwirtschaftliche Nutzung – Theorie und Praxis klaffen auseinander
Die Theorie klingt gut: Stromproduktion und Landwirtschaft auf derselben Fläche, höhere Flächeneffizienz, Synergien. In der Praxis melden aber gerade Landwirte erhebliche Zweifel. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist darauf hin, dass Agri-PV nur dann sinnvoll ist, wenn Bewirtschaftung und Ertrag realistisch gesichert sind – und nicht, wenn die Landwirtschaft nur als Feigenblatt dient.

Im Ausschuss wurde deutlich, dass die Landwirte vor Ort den geplanten Aufbau für kaum praxistauglich halten. Weder ist klar, mit welchen Maschinen zwischen den Modulreihen gearbeitet werden kann, noch ist gesichert, welcher Landwirt die Fläche unter diesen Bedingungen überhaupt bewirtschaften will.
Irritierend ist auch die Aussage des Projektentwicklers, dass Schafbeweidung nicht als landwirtschaftliche Nutzung anerkannt werde. Das Niedersächsische Umweltministerium stellt dagegen in seinem offiziellen FAQ zum Agri-PV- und Beteiligungsgesetz klar:
- Freiland-Tierhaltung (dort: Geflügelhaltung) gilt ausdrücklich als „landwirtschaftliche Bewirtschaftung“ im Sinne der Agri-PV-Definition.
- Eine maschinelle Bewirtschaftung ist keine Voraussetzung, entscheidend ist die primäre landwirtschaftliche Nutzung.
Wenn Tierhaltung anerkannt ist, ist es zumindest erklärungsbedürftig, warum ausgerechnet Schafe pauschal ausgeschlossen sein sollen. Aus Sicht der UWG muss das mit den zuständigen Fachbehörden (Landwirtschaftskammer, Umweltministerium) sauber geklärt werden.

Solange kein belastbares landwirtschaftliches Nutzungskonzept vorliegt – mit konkretem Bewirtschafter, Kulturarten bzw. Tierhaltung, Bewirtschaftungswegen und Ertragsprognose – ist das Label „Agri-PV“ nicht mehr als ein Etikett.
0,2 Cent je kWh – was bedeutet das wirklich für Jesteburg?
Der Projektentwickler hat zugesagt, die Gemeinde auch bei einer Agri-PV-Anlage mit 0,2 Cent je eingespeister Kilowattstunde zu beteiligen (= ca. 11.700 Euro jährlich). Für den Betreiber ist es kein finanzielles Opfer, sondern im Kern ein durchgeleiteter Betrag. Er kann sich diesen Betrag vom Netzbetreiber erstatten lassen.
Keine Kopplung mit dem Bebauungsplan
Das Umweltministerium stellt ausdrücklich klar: Eine Gemeinde darf nicht vereinbaren, dass eine Flächenzuweisung oder ein Beschluss nur dann erfolgt, wenn der Betreiber über die gesetzlichen Pflichten hinaus zusätzliche Zahlungen leistet.
Das bestätigt die Einschätzung der Verwaltung: Die Frage „Bebauungsplan ja oder nein?“ darf rechtlich nicht an Sonderzahlungen gekoppelt werden.

Wenn in Thelstorf eine 0,2 ct/kWh-Vereinbarung getroffen wird, dann muss sie rechtssicher, langfristig und mit echten Sicherheiten unterlegt werden – und zwar getrennt vom Bebauungsplanverfahren.
Der Projektentwickler plant für die Anlage die Gründung einer haftungsbeschränkten Projektgesellschaft in der Unternehmensform „UG & Co.KG„. Die Komplementärin (UG) haftet zwar formal unbeschränkt, aber nur mit ihrem eigenen – oft sehr begrenzten – Vermögen. Die eigentlichen Investoren sind Kommanditisten und haften nur mit ihrer Einlage.
Geriete das Projekt oder die Projektgesellschaft in Schieflage, stünde Jesteburg mit Zahlungsansprüchen schnell mit leeren Händen da. Sollte diese Gesellschaftsform tatsächlich gewählt werden, müssen finanzielle Zusagen durch harte Sicherheiten (z.B. eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft) absichert werden. Ohne solche Sicherheiten sind Zahlungsversprechen einer UG & Co.KG politisch nicht verantwortbar.
Gewerbesteuer: Chancen ja – aber keine Wundereinnahmen
Der Projektentwickler hat im Ausschuss darauf hingewiesen, dass der Sitz der Gesellschaft „zweitrangig“ sei, die Gewerbesteuer falle am Ort der Stromerzeugung an.
Die Realität ist etwas komplizierter: Grundsätzlich fließt die Gewerbesteuer dem Ort zu, an dem das Unternehmen seine Betriebsstätte hat. Bei Solar- und Windparks mit Sitz woanders wird die Steuer zwischen Sitz- und Standortgemeinde aufgeteilt. Seit 2021 gilt bundesweit: Bei Wind- und Solaranlagen wird die Gewerbesteuer zu 90 % nach der installierten Leistung auf Standort- und Sitzgemeinde verteilt. Vollständig sicher ist der Zufluss aber nur, wenn Gewinne erwirtschaftet werden – und das hängt von vielen Faktoren ab (Strompreis, Finanzierung, Betriebskosten etc.).

Für Jesteburg heißt das:
Ja, die Gemeinde kann von der Gewerbesteuer profitieren – aber nur, wenn die Anlage wirtschaftlich erfolgreich ist und das Finanzamt entsprechende Gewinne feststellt. Feste, seriös bezifferbare Mehreinnahmen lassen sich heute nicht versprechen.
Abstände und Nachbar-Bauland: Kriterienkatalog gilt auch hier
Ein Anwohner hat im Ausschuss darauf hingewiesen, dass seine angrenzende Fläche vom Finanzamt als Bauland behandelt und entsprechend besteuert wird. Damit stellt sich die Frage, ob für die Agri-PV-Anlage dieselben Abstandsgebote gelten müssen, die sich die Gemeinde in ihrem Kriterienkatalog für PV-Freiflächen selbst auferlegt hat. Hier braucht es eine klare, nachvollziehbare rechtliche Bewertung – und wenn nötig eine Anpassung des Bebauungsplans.
Unser Fazit:

Offenes Prüfverfahren ja – Blankoscheck nein
Die UWG hat der Änderung des Aufstellungsbeschlusses zugestimmt, um das Verfahren fortzuführen und alle offenen Fragen sauber prüfen zu lassen. Eine Zustimmung zum konkreten Projekt ist damit nicht verbunden.
Unsere roten Linien:
- Echte landwirtschaftliche Hauptnutzung, nicht nur ein Etikett „Agri-PV“.
- Ein tragfähiges, namentlich hinterlegtes Bewirtschaftungskonzept.
- Einhaltung der gemeindlichen Kriterien – einschließlich Abständen zu bestehenden und potenziellen Bauflächen.
- Rechtssichere, langfristige finanzielle Beteiligung der Gemeinde mit konkreten Sicherheiten.
- Transparente Darstellung der zu erwartenden, aber unsicheren Gewerbesteuereffekte.
Solange diese Punkte nicht erfüllt sind, wird es von der UWG kein Ja zu einem Bebauungsplan für die Anlage in Thelstorf geben. Energiewende ja – aber bitte mit ehrlicher Landwirtschaft, fairen Rahmenbedingungen für die Nachbarn und verlässlichem Nutzen für Jesteburg.